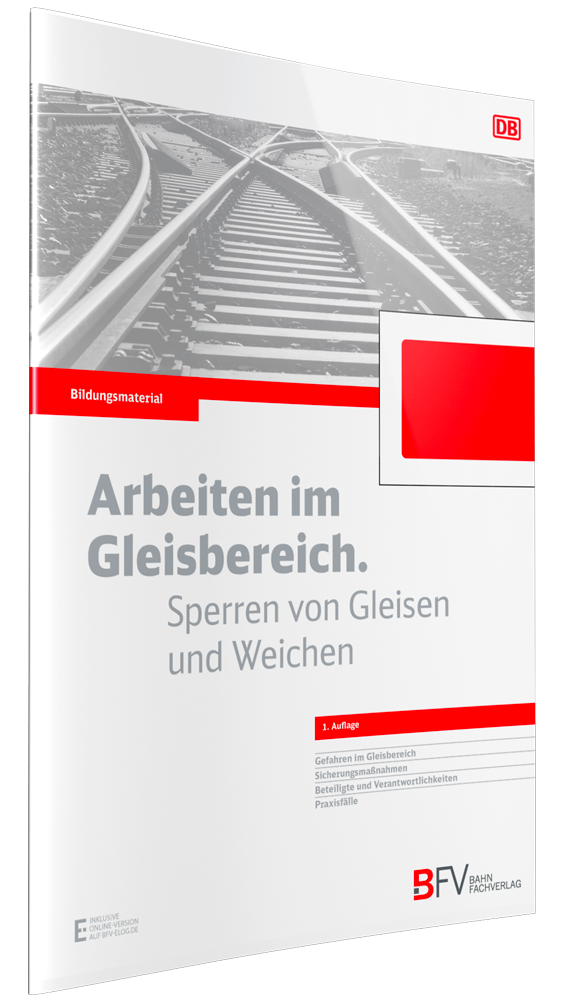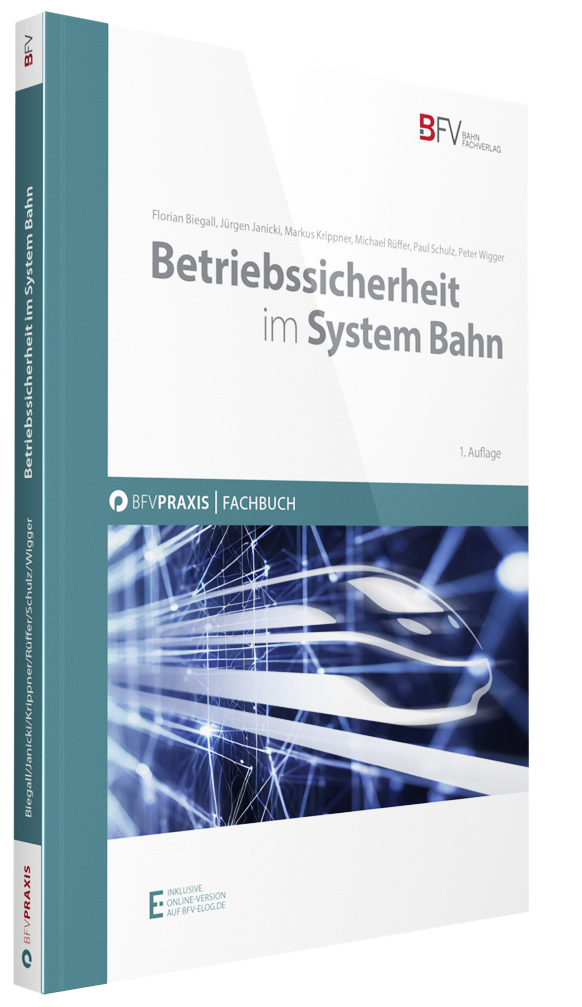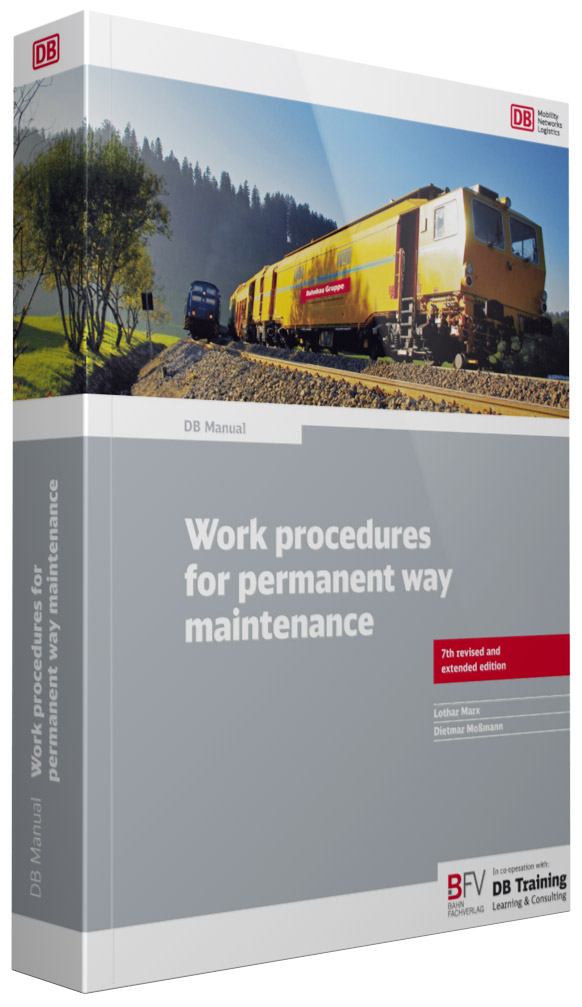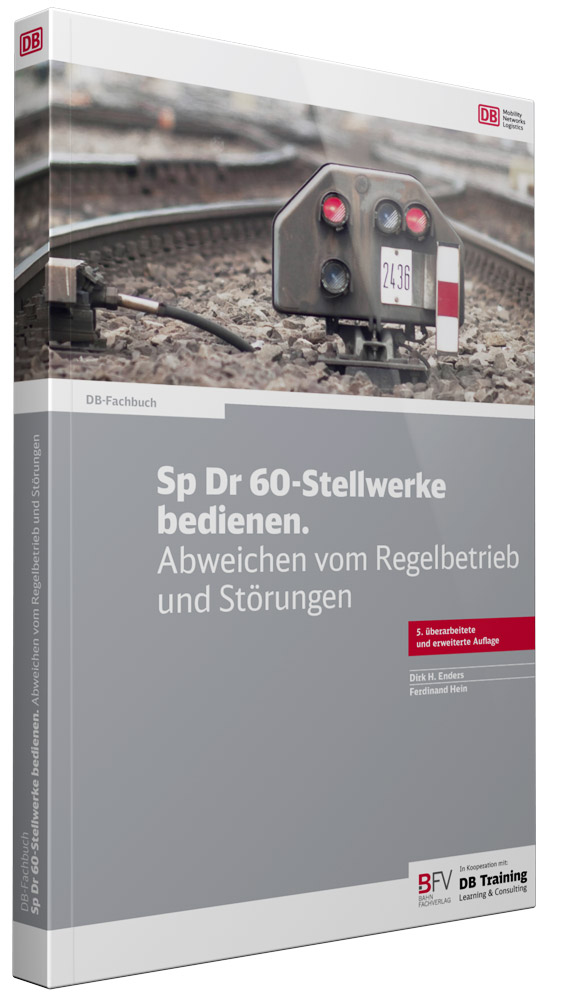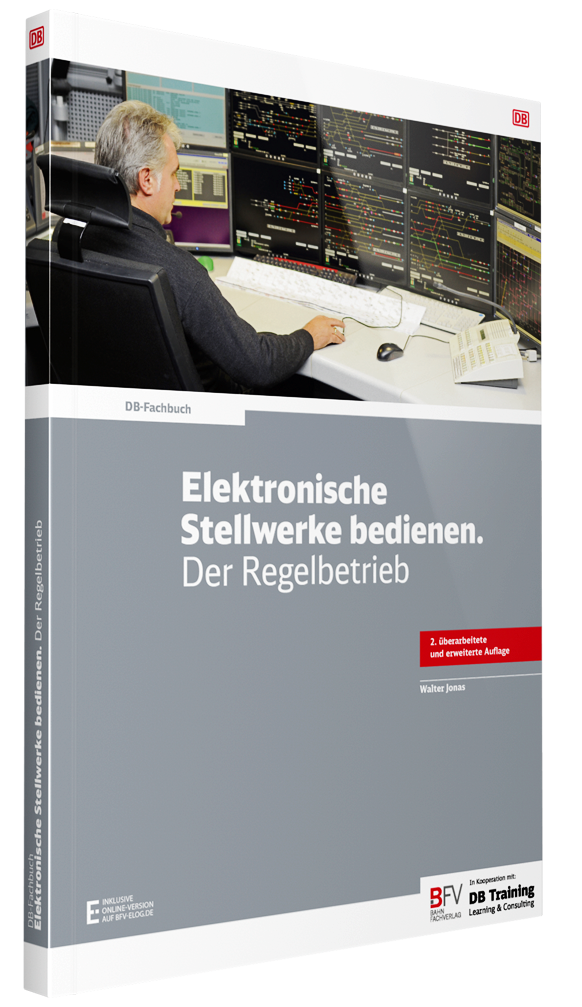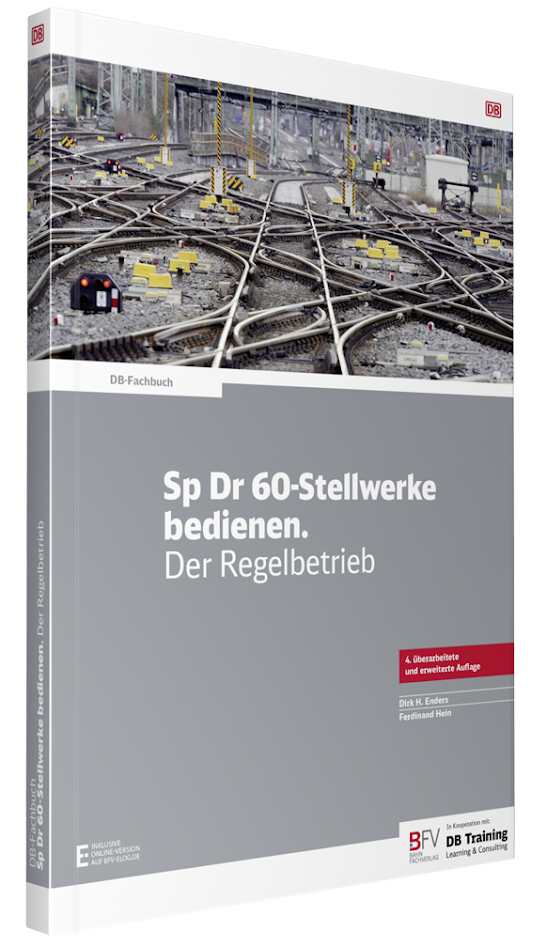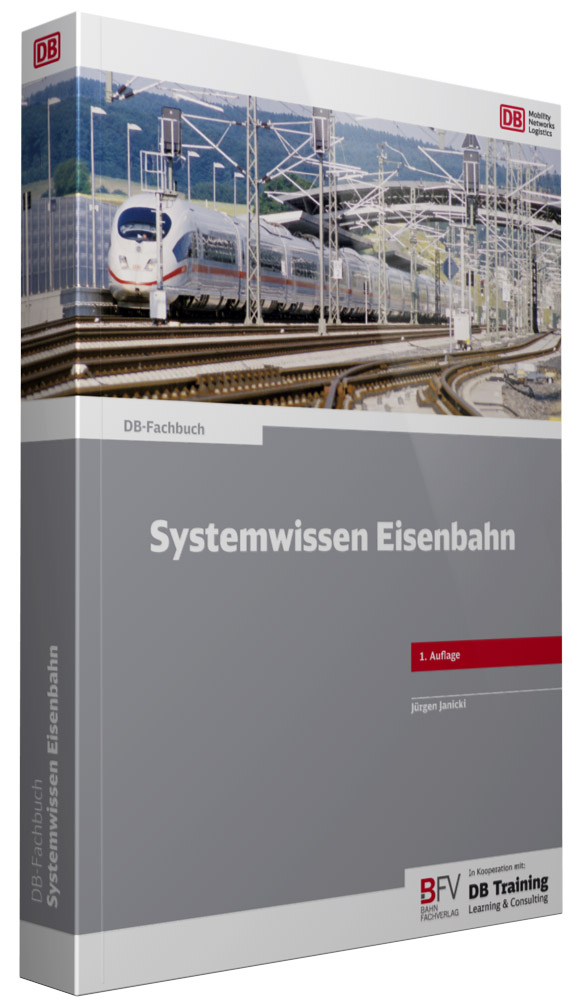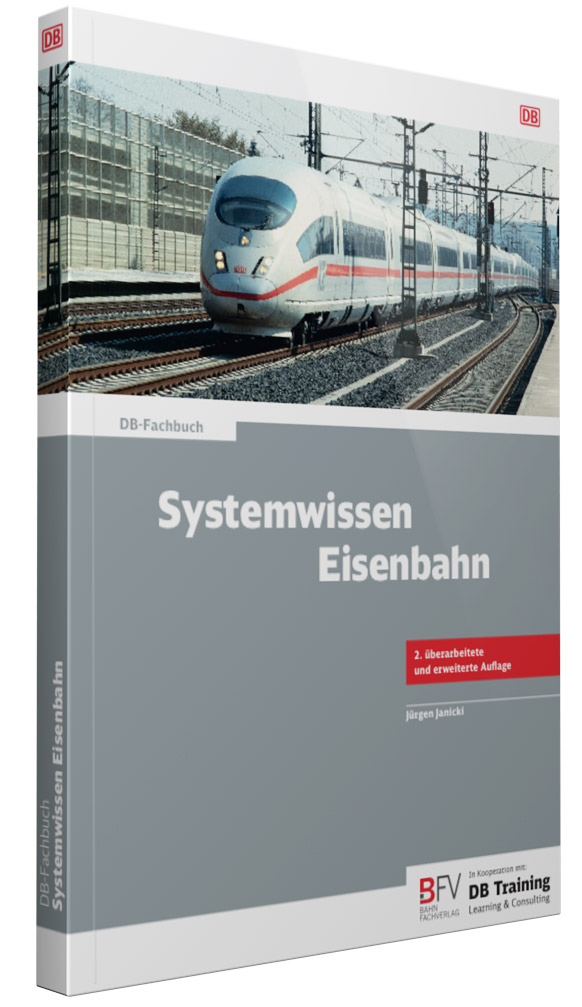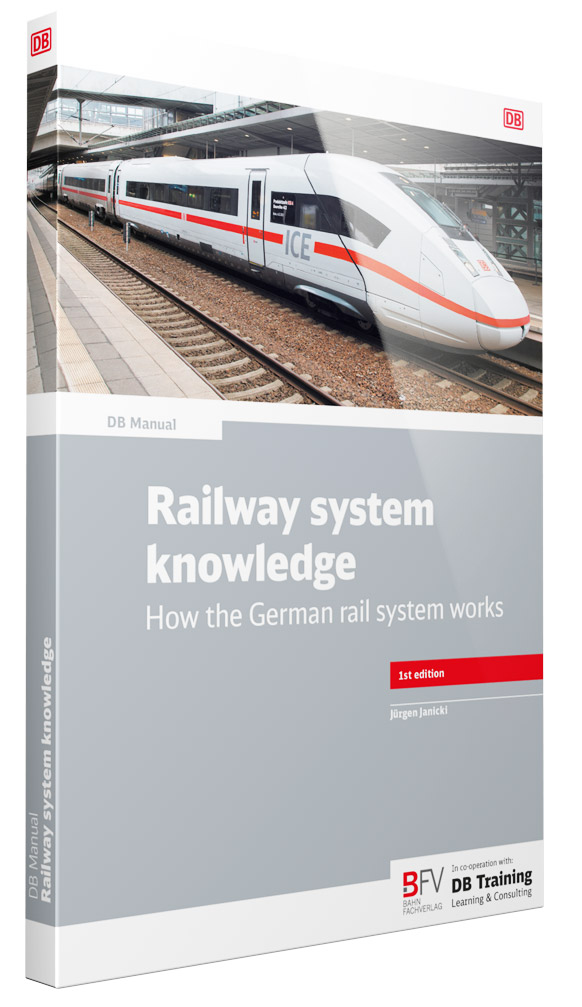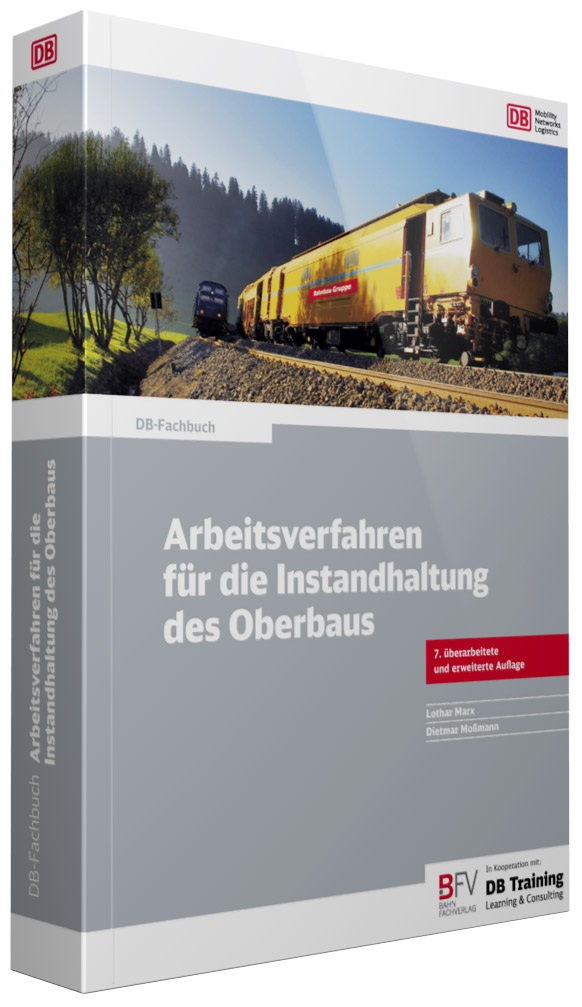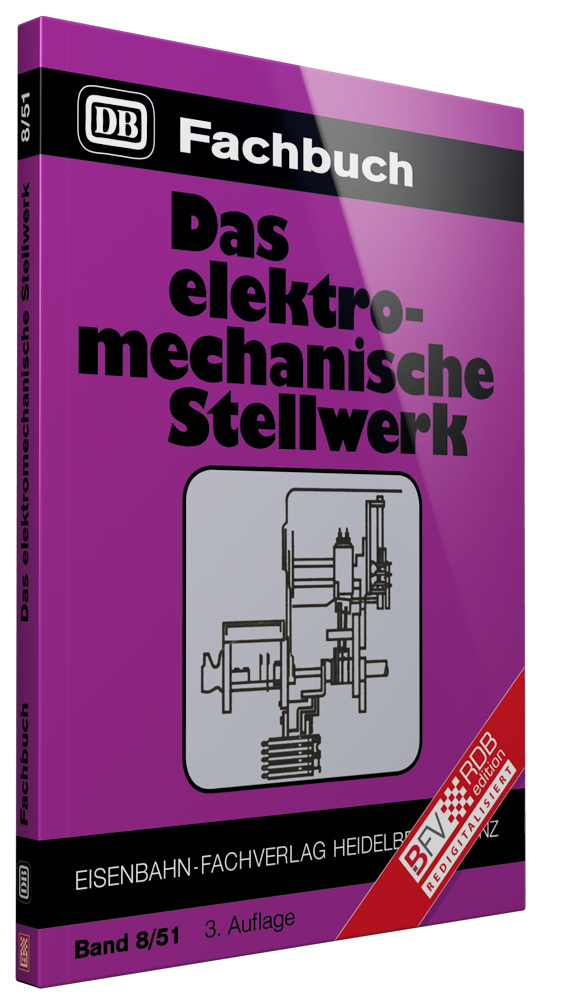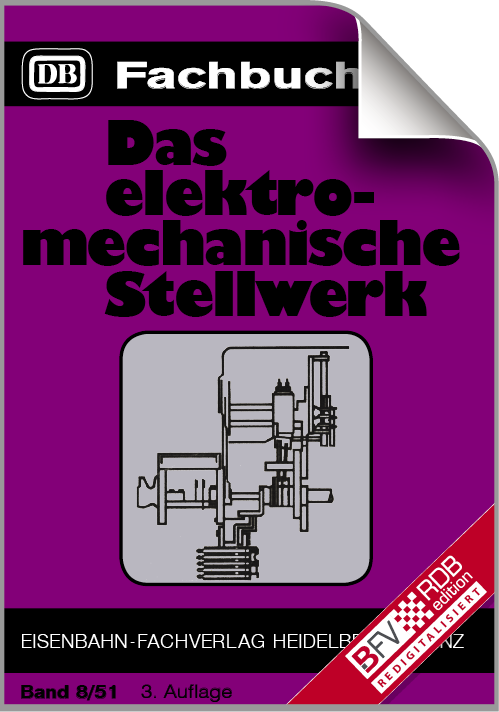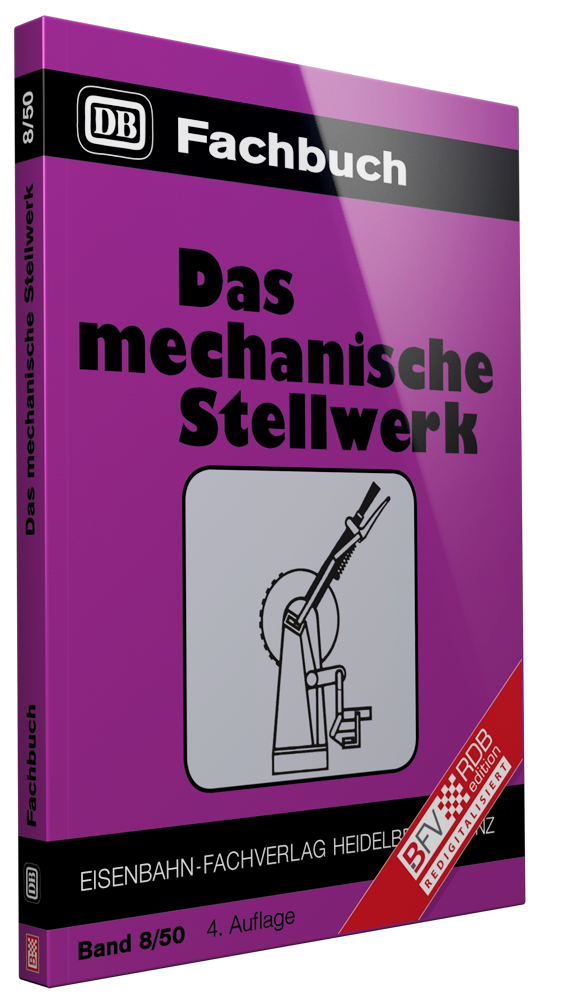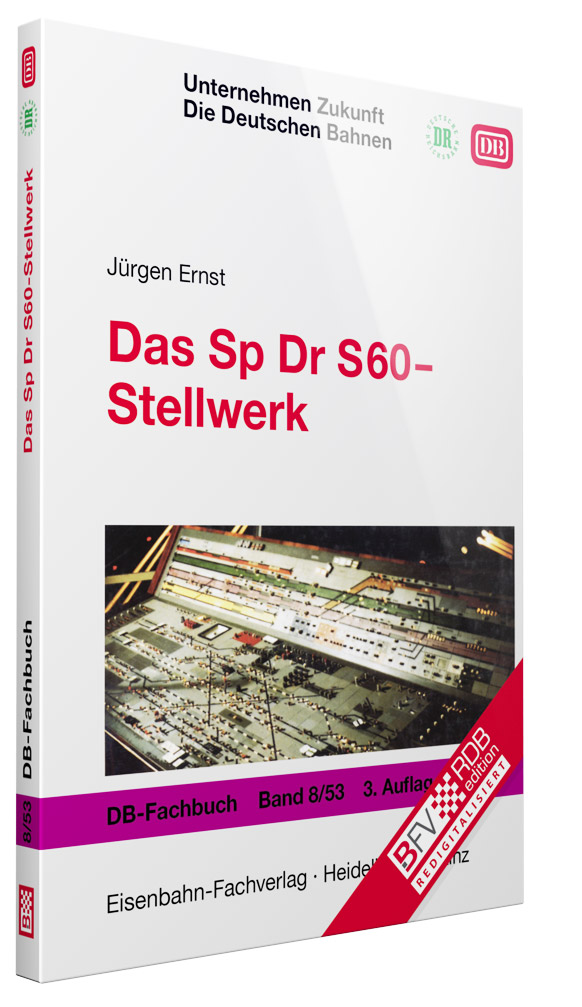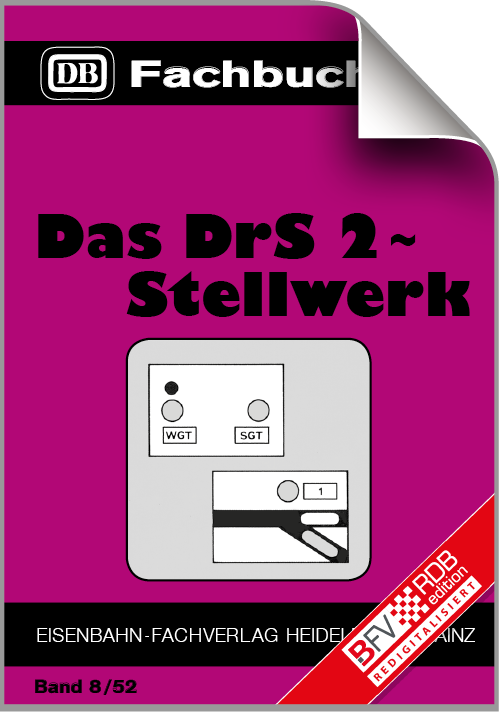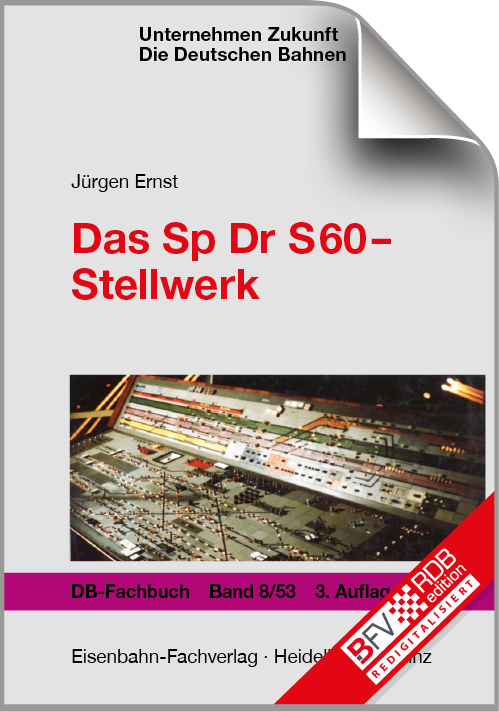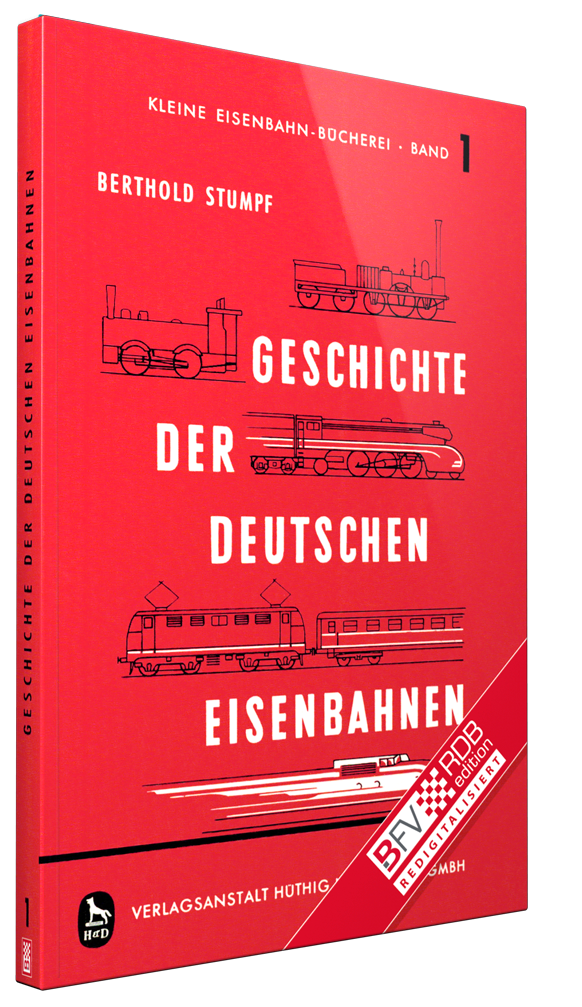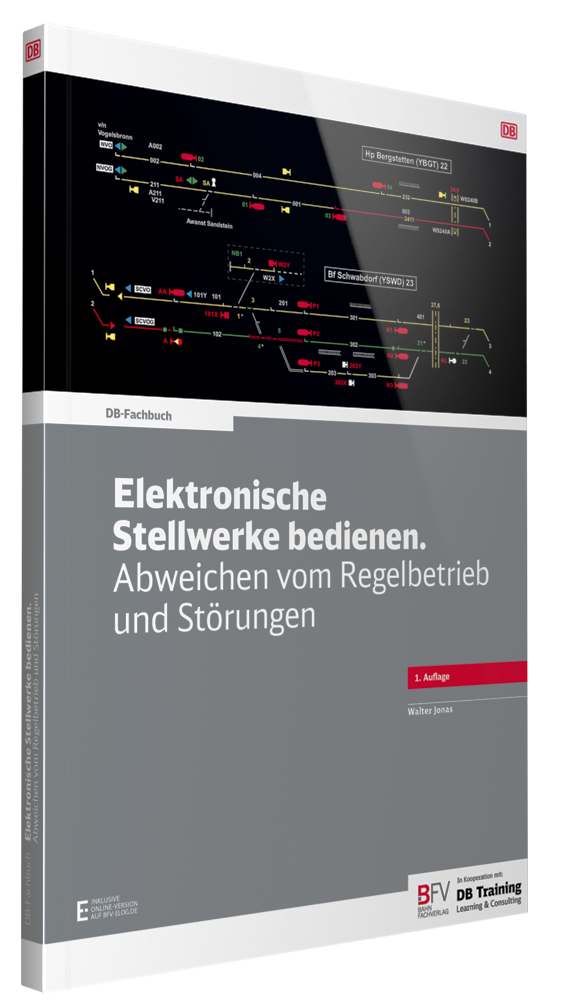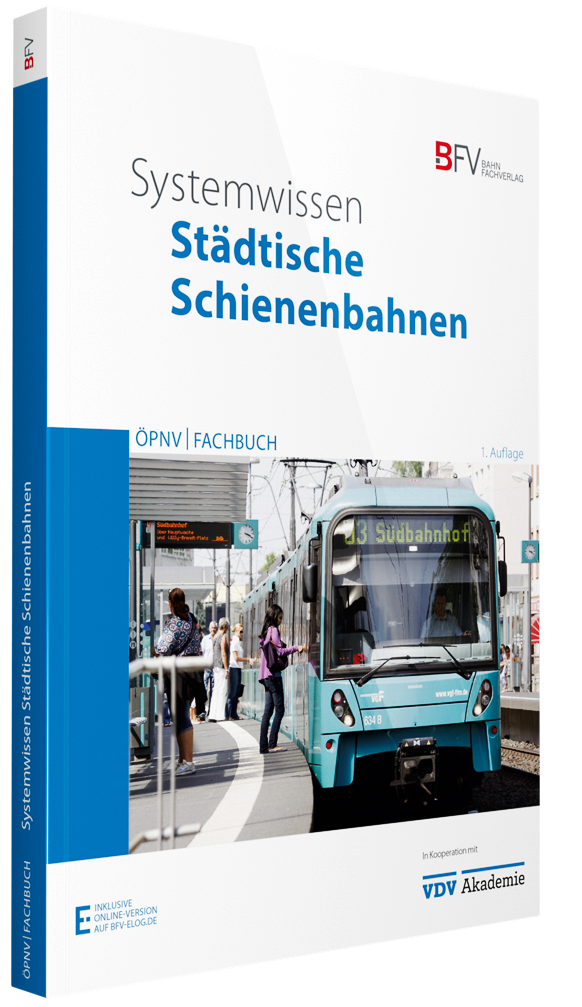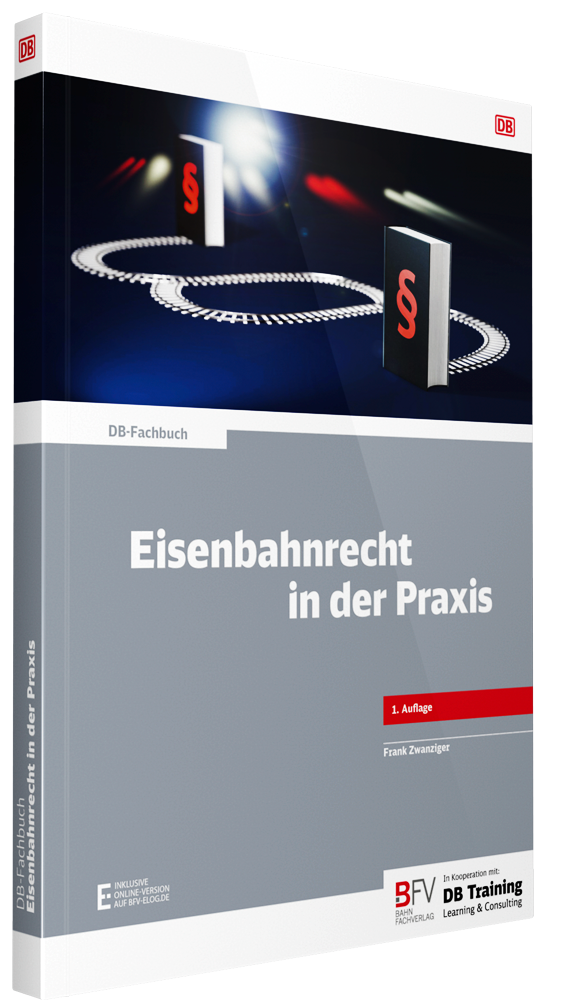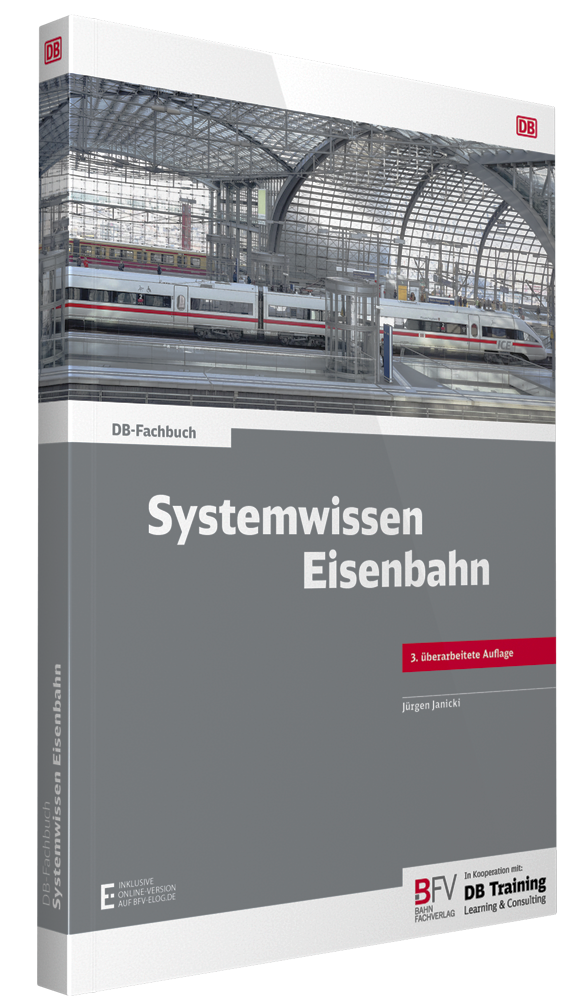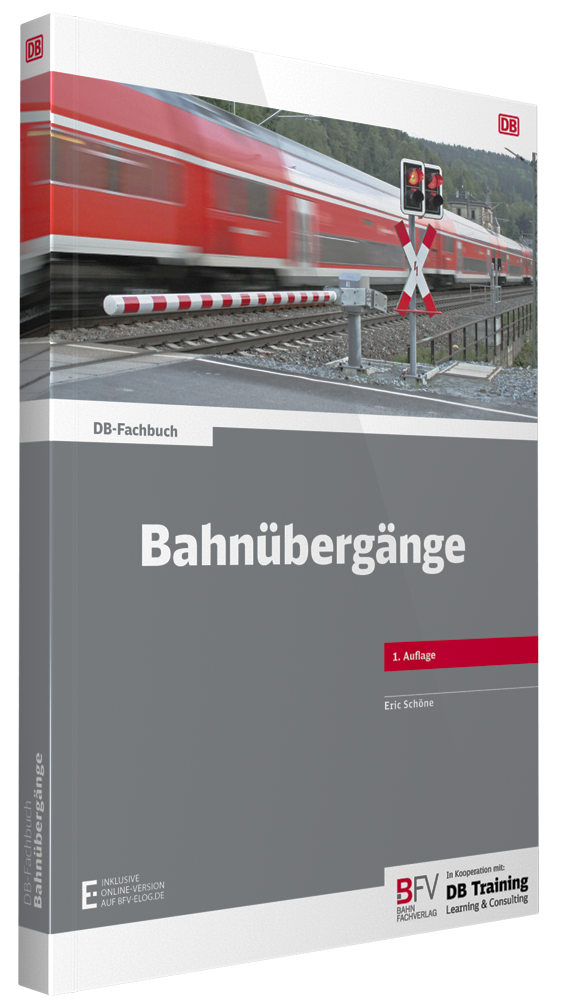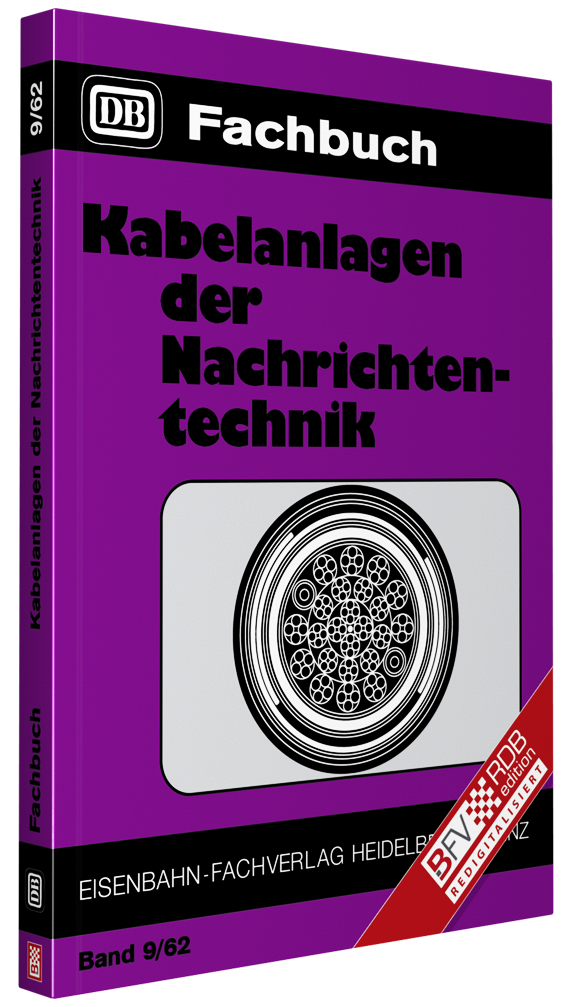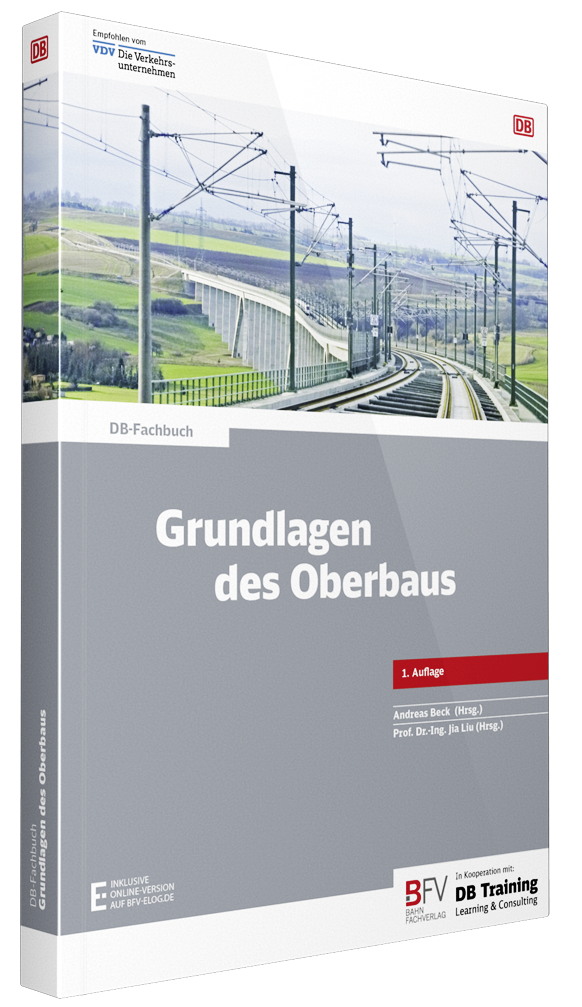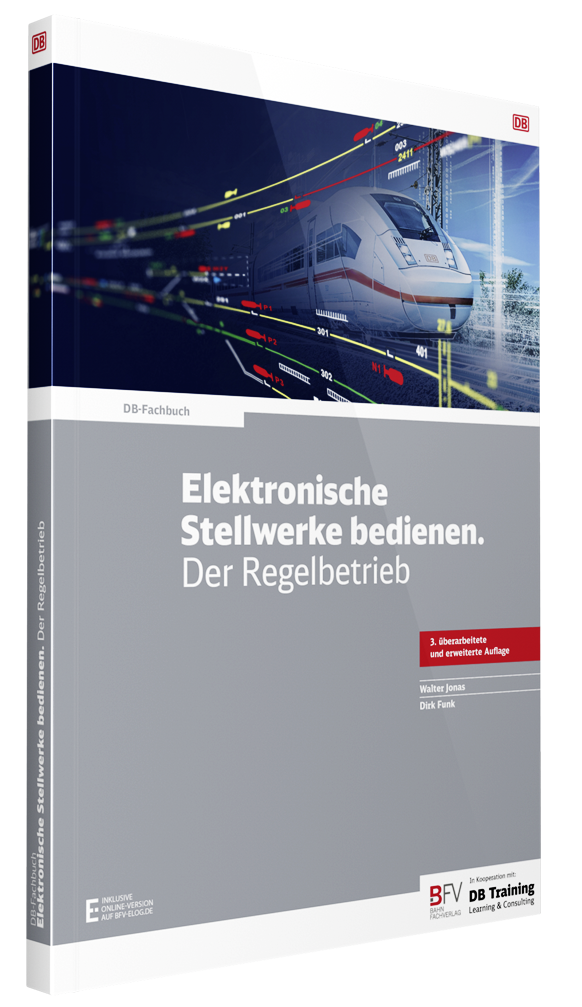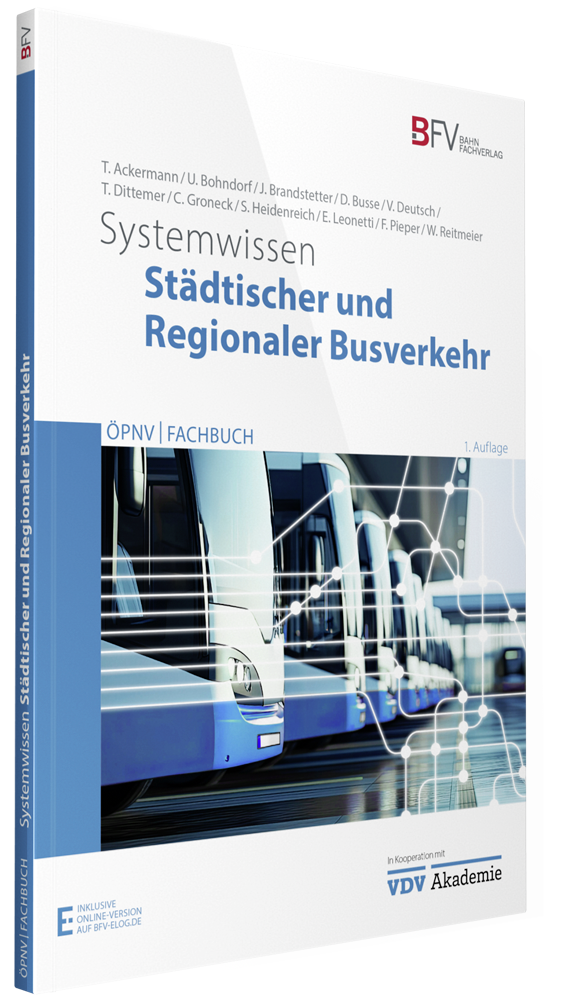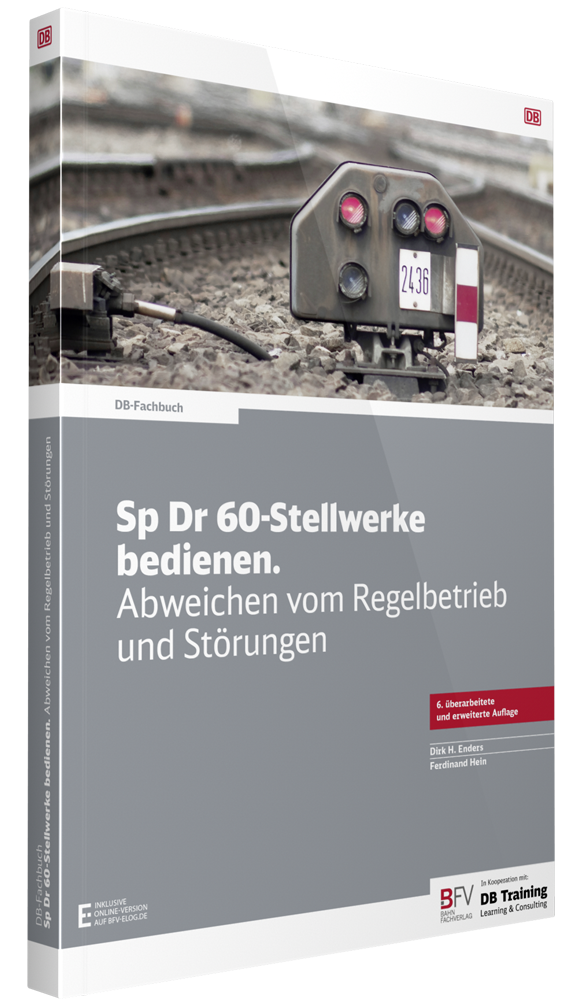Zum 14. Mal hat der Verband der Verkehrsunternehmen im Bahnbetrieb tätige Fach- und Führungskräfte zum jährlichen Austausch eingeladen – dieses Mal in die Sachsenmetropole Leipzig. Auf dem Programm stand wie gewohnt eine breite Themenpalette von Betriebsregelwerk über Innovationen bis zu Personalmanagement. Ein starker Fokus lag auf dem Ausbau und der Nutzung der Infrastruktur aus der Perspektive nichtbundeseigener Bahnen.
Der erste Kongresstag begann mit einer Personalie: Moderator Carsten Hein stellte Nicole Knapp als neue Geschäftsführerin Eisenbahnverkehr des VDV vor. Knapp, vormals Pressesprecherin bei der Deutschen Bahn, sprach den anwesenden Eisenbahnbetriebsleitenden (EBL) Respekt für ihre verantwortungsvolle Rolle bei der Gewährleistung eines sicheren Bahnbetriebs aus. Sie adressierte einige aktuelle Branchenthemen und betonte, beim Ausbau des Netzes und der Reaktivierung von Strecken dürften die NE-Bahnen nicht vergessen werden, die ebenfalls Infrastruktur betreiben – und damit leitete Knapp den folgenden ersten Vortrags-Block ein.
Infrastrukturausbau und Reaktivierung: Jeder Meter Schiene zählt
Ralf Uekermann von der Bentheimer Eisenbahn stellte den fahrplanorientierten Infrastrukturausbau im Projekt Regiopa vor, welches vom Aufgabenträger des Landes Niedersachsen LNVG gefördert wird. Eine Besonderheit ist der grenzüberschreitende Verkehr mit gemeinsamer Infrastrukturnutzung in den angrenzenden Niederlanden (Pro Rail).
Die Planung orientiert sich ganzheitlich an der Reisekette, inklusive kundenfreundlicher Bahnhöfe und einem Busnetz im Eigenbetrieb. Die hohe Umsetzungsgeschwindigkeit ist zum einen auf die Unterstützung und das Commitment des Landkreises (Grafschaft Bentheim) zurückzuführen, erläuterte Uekermann. Zum anderen wurde alles zentral im EVU gemanagt bzw. in Eigenregie erbracht – Schnittstellen zu vermeiden ist laut dem Referenten ein Erfolgsfaktor solcher Vorhaben.
Ralf Böhme, Vorstand der Deutsche Eisenbahn Service AG, sprach für eines der letzten inhabergeführten Bahnunternehmen. Er unterstrich die unterschätzte Bedeutung der NE-Bahnen für die Infrastruktur – jeder Meter Schiene zählt für das Gesamtsystem. Die privaten Infrastrukturen befinden sich in der Regel in der Fläche und haben somit eine wichtige Entlastungs- und Umleitfunktion für das DB-Netz, etwa im Zuge der Generalsanierungen, so Böhme. Den Kosten für den Betrieb der Infrastruktur stehe jedoch die eher geringe SPNV-Nachfrage im ländlichen Raum gegenüber.
Streckenkenntnis: Auf Datenverfügbarkeit kommt es an
Sascha Fiebig von DB Cargo erläutert den Ablauf und die Vorteile des digitalen Streckenkenntniserwerbs per Video. Dies bietet Wirtschaftlichkeit in der praktischen Durchführung, z. B. durch bessere Verfügbarkeit der Fahrzeuge und höhere Qualität der Ausbildung, da auch Gefahrensituationen dargestellt werden können. Der Videoerwerb soll der bevorzugte Weg zur Streckenkenntnis für die Mitarbeitenden sein, Mitfahrten werden aber weiterhin angeboten und sind in manchen Fällen auch erforderlich. Nachteilig für das Verfahren sei die fehlende direkte Verfügbarkeit elektronischer Daten zum Streckenzustand.
In diesem Zusammenhang kam Regelwerks-Experte Götz Walther auf die kurz zuvor veröffentlichte Neufassung der VDV-Schrift 755 zu sprechen. Zustandsdaten werden nicht nur für Schulungen, sondern auch für die Verkehrs- und Einsatzplanung benötigt. Herausforderungen sind der interoperable Datenaustausch, aber auch Unklarheiten oder abweichende Begrifflichkeiten in der EU-Interoperabilitätsrichtlinie. Walther kündigte ein Pilotprojekt des VDV zur systemischen Streckenkenntnis an.
Fachkräftemangel: Prozesse automatisieren, Wissen teilen
Der von der FH Aachen an die dortige Technische Universität gewechselte Schienenfahrzeug-Professor Raphael Pfaff stellte sein neues Institut vor und thematisierte die Problematik des hohen Personalaufwands im Vorbereitungsdienst. Er stellte die Frage, warum der Zug nicht zum Fahrer kommen kann, wie bei Autos mit hochentwickelten Assistenzfunktionen, und präsentierte das SAMU-Projekt für automatisierte Abstellfahrten.
KI sei für die Umfelderkennung noch keine Option, da die Fehlerrate zu hoch bzw. das geforderte Sicherheitsniveau nicht nachweisbar ist; daher wird eine vergleichsweise einfache Lösung über Sensoren bevorzugt. Das Projektbeispiel zeigt, dass man niedrigschwellig anfangen sollte – es muss nicht immer eine große Automatisierung sein, unterstrich der Professor.
Im Kontext des Fachkräftemangels in der Branche bewegte sich auch der Vortrag von Stefanie Menke, Leiterin des Bereichs New Learning bei der VDV-Akademie. Sie sprach über die Bedeutung des Wissenstransfers von erfahrenen, ausscheidenden Mitarbeitenden an ihre Nachfolger, ein Thema, dem sich die VDV-Schrift 803 und die Plattform knowhow.vdv.de widmen. Ein Lösungsansatz ist die von der Akademie entwickelte Bildungsplattform MoNet, die in sechs Themenwelten geclustert ist und Vernetzung in Communities ermöglicht, wo Wissen geteilt und geholt werden kann.

Eisenbahnrecht: Das Planen und Bauen soll schneller gehen
In seinem Rundgang durch die aktuelle schienenrelevante Gesetzgebung informierte VDV-Experte Markus Ring unter anderem über den Koalitionsvertrag der Regierungsparteien, der allgemeine Pläne und beschleunigende Ansätze sowie bahnspezifische Vorhaben enthält. Im Sinne der Planungsbeschleunigung ist eine Überarbeitung diverser Vorschriften geplant, z. B. bei der Umweltverträglichkeitsprüfung. Ebenso strebt die Regierung ein einheitliches Verfahrensrecht für Infrastrukturprojekte an.
Alle aus dem neuen Sondervermögen finanzierten Projekte sollen künftig als überragendes öffentliches Interesse eingestuft werden, erläuterte Ring. Gemäß dem im Juni verabschiedeten Kabinettsbeschluss sind 166 Milliarden Euro für Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur vorgesehen. Bedenken bestehen dahingehend, dass diese Summe über 10 Jahre gestreckt ist und bei steigenden Baukosten weniger Bauleistung erbracht wird als mit den gleichen Mitteln zu heutigen Preisen.
Der Zeitraum für die im vergangenen Jahr angelaufenen Generalsanierungen im DB-Schienennetz wird über den ursprünglich geplanten Zeitraum bis 2030 hinaus gestreckt, da weniger Korridore pro Zeitraum saniert werden sollen. Gegen den Bauherrn DB InfraGO wurden Strafen wegen nicht fristgerechter Information über Baumaßnahmen und damit verbundene Streckensperrungen verhängt, berichtete Ring. Ebenso sind Zwangsgelder vorgesehen bei der Unterbesetzung von Stellwerken, für welche der Infrastrukturbetreiber eine Bereitstellungspflicht habe.
Zugfunk: Der langsame Abschied von GSM-R
Ein weiteres Modernisierungsvorhaben der Infrastruktur, das alle im DB-Netz verkehrenden EVU betrifft, wirft seine Schatten voraus: Die Umstellung des bahnbetrieblichen Funksystems von GSM-R auf den neuen 5G-basierten Standard FRMCS.
Michael Zimmer, verantwortlicher Projektleiter bei der DB InfraGO, berichtete über die Ausgestaltung des Übergangszeitraum bis 2029 und betonte, es werde kein hartes Umschalten geben, sondern beide Systeme laufen während der Umstellung parallel. Ab 2030 werde es aber definitiv kein GSM-R mehr geben, da die Hersteller keine Teile mehr liefern. Eine Herausforderung im Projekt sei der rechtzeitige Aufbau der benötigten Funkmasten.
Seitens der Teilnehmenden wurde der Wunsch nach rechtzeitiger Einbindung der NE-Bahnen geäußert, die einen Alleingang der InfraGO befürchten. Das dies nicht ganz unberechtigt ist, zeigte die Antwort auf eine Frage nach der Rückfallebene des neuen Funksystems: Das Konzept dafür sei noch in Arbeit, so Zimmer, das 2G-Netz stehe jedoch nicht mehr zur Verfügung, da der Netzbetreiber Telekom das System abgekündigt hat – dies wurde vom Publikum kritisch aufgenommen.

Terrorismus und Spionage: Keine Panik, aber Aufmerksamkeit
Zwei neue Gesetze setzen EU-Vorgaben zum Schutz kritischer Infrastruktur und zur Cyber-Abwehr um. Experten gehen von einer zunehmenden Gefährdung von Bahneinrichtungen durch Terrorismus aus. Diesem Thema widmete sich der Vortrag von Markus Schöndorf, Kriminaldirektor beim Bundeskriminalamt (BKA).
Schöndorf erläuterte Verfahren im Umgang mit Gefährdungslagen im Referat Polizeilicher Staatsschutz des BKA, das für politische Gewalt zuständig ist und Hinweise und Meldungen mit Blick auf die Wahrscheinlichkeit von Anschlägen bewertet. Von Rechts gibt es nach Einschätzung der Behörde grundsätzlich kein Interesse an der Bahn, die nur indirekt betroffen sein kann, etwa wenn Versammlungen im Umfeld von Bahnhöfen stattfinden. Von linker Seite steht die Sachbeschädigung an Gleisen und Anlagen im Fokus. Motivation dahinter ist, dass die Bahn als Staatsorgan wahrgenommen wird und sich z. B. an Transporten militärischer oder umweltgefährdender Güter beteiligt.
Es besteht jedoch eine Bedrohung seitens sogenannter religiöser Ideologien wie dem Islamismus – eine absichtlich herbeigeführte Entgleisung eines ICE wäre aus Sicht der Terroristen vergleichbar mit dem Stellenwert eines Flugzeugabsturzes. Aktuell sieht das BKA jedoch keine Hinweise auf konkrete Absichten oder Pläne, der letzte Versuch dieser Art wurde 2018 aufgedeckt.
Die Schieneninfrastruktur ist schon seit langem Objekt geheimdienstlicher Aufklärung, unter anderem durch Russland, informierte der Beamte. Dabei werden zunehmend hybride Mittel eingesetzt, insbesondere die sogenannten Wegwerf-Agenten: oft sind deren Taten schwierig als solche zu erkennen, wie kleinere Brandanschläge oder die Montage kleiner Kameras an Bahnanlagen.
Die Konzernsicherheit der Deutschen Bahn wurde vom BKA für diese neue Art der Bedrohung sensibilisiert. Auf Nachfrage aus dem Publikum bestätigte Schöndorf, dass Güterbahnen, die militärisches Gerät transportieren, ins Visier ausländischer Geheimdienste geraten können. Panik sei nicht angebracht, er rät aber zu verstärkter Aufmerksamkeit für Anzeichen von Spionage oder Sabotage.
Lesen Sie auch:
Artikel als PDF laden